Der Juli 2025 startete heiß, mit Höchsttemperaturen überall in Deutschland, Trockenheit und Hitze. Derzeit sorgt ein Tiefdruckgebiet zwar für Abkühlung und Regen. Aber auch das ist keine Entwarnung. Denn entweder regnet es zu wenig, um die Böden tatsächlich wässern zu können – oder zu viel, und das Wasser fließt in Sturzfluten ab.
Solche Extremwetterereignisse werden seit einigen Jahren häufiger und mit der Klimakrise immer schlimmer. Waldbrände und Überflutungen nehmen gleichermaßen zu. Trockenheit sorgt für Ernteausfälle und damit höhere Lebensmittelpreise – und langfristig auch zu Lebensmittelknappheit. Ein Landbaukonzept, das Bäume und Sträucher mit in die Landwirtschaft integriert, könnte hier Abhilfe schaffen: der Agroforst.
Was ist ein Agroforst?
Ein Agroforst ist ein Landnutzungssystem, das gewöhnliche Ackerkulturen mit Bäumen, Sträuchern oder auch Tierhaltung auf einer landwirtschaftlichen Fläche kombiniert. Die derzeit am meisten verbreitete Form des Agroforst ist eine abwechselnde Anordnung von Äckern und Baumstreifen, welche die Flächen unterteilen und dennoch einfach zu bewirtschaften halten.
Je nach Nutzungsart unterscheiden sich die Bäume und Kleingehölze, die in einem Agroforst eingesetzt werden können. So gibt es zum Beispiel Agroforste, in denen Äcker von Obstbäumen durchtrennt sind, ähnlich wie Streuobstwiesen. Auch das Obst findet Verwendung, es wird ebenso wie die Feldfrüchte geerntet und verkauft oder zu Saft verarbeitet. In anderen Agroforsten sind Hecken, Sträucher und Büsche gepflanzt.
Wie funktioniert das Konzept Agroforst?
Bäume und Sträucher an den Feldrändern unterstützen die angrenzenden Äcker direkt. Sie schützen den Boden vor Erosion, da sie den Boden einfacher und effektiver festhalten, als es die üblichen Feldfrüchte können. Damit sind die Äcker besser vor Abtragung geschützt. Eine Vielfalt in den Pflanzen trägt auch zur Vielfalt im Boden bei: Nützliche Insekten und Kleintiere wie Ameisen oder Regenwürmer fühlen sich wohler. Mit ihrer Unterstützung gewinnt der Boden an Humus, einer fruchtbaren Oberschicht, welche die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhöht.
Ein lockerer, weniger verdichteter Boden kann Regenwasser viel besser aufnehmen und speichern: Schwammwirkung statt Schlammlawine. Die Äste und Blätter der Bäume und Sträucher bremsen zudem den Wind und schützen den Acker so zusätzlich davor auszutrocken oder abgetragen zu werden. Die Bäume und Sträucher sorgen dazu noch für angenehmere Temperaturen durch Schatten und Verdunstung.
Bäume als Wassersäufer?
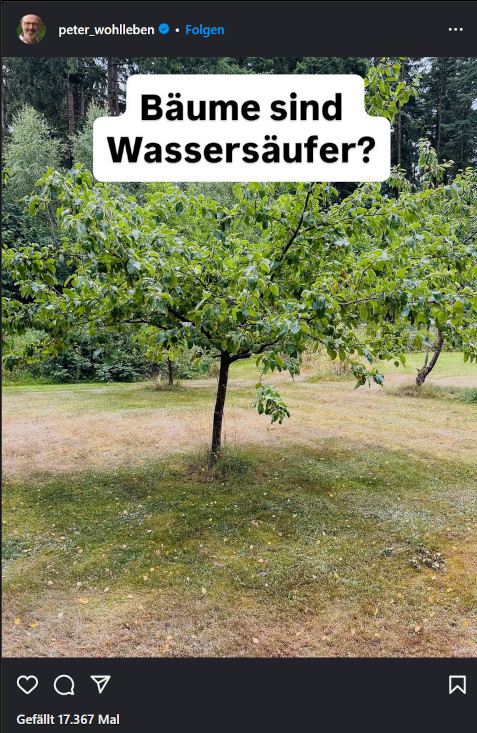
Der Mythos, dass Bäume dem Boden nur Wasser entziehen, hält sich hartnäckig. Baum- und Waldexperte Peter Wohlleben hält in diesem Instagram-Post dagegen.
Dazu kommt: Vielfältig gestaltete Agroforstsysteme erhöhen die Struktur- und Artenvielfalt und liefern Lebensraum für Tiere und Pflanzenarten, die sonst auf dem Acker keinen Platz hätten. Blühstreifen an Ackerrändern sind davon die Vorstufe; sie bieten Lebensraum für bestäubende Insekten, was auch der Landwirtschaft zugutekommt. Bäume schaffen zusätzlich Sitzplätze für Greifvögel, die dann auf Wühlmausjagd gehen. Baumreihen und Blühstreifen zwischen Äckern können als verbindende Brücken für Tier- und Pflanzenarten funktionieren, deren Lebensräume sonst zerschnitten würden.
Baumreihen können außerdem einer Übersättigung des Bodens vorbeugen und verhindern nachweislich, dass Schadstoffe, wie zum Beispiel überschüssiges Nitrat aus Düngern, in den Boden oder das Grundwasser eindringen.
Studien zeigen, dass die Erträge auf Agroforst-Flächen über die Jahre stabiler und sogar größer sind als auf vergleichbaren, regulären Anbauflächen. Richtig durchgeführt, profitieren auch die Landwirt*innen davon, weil sie mehr unterschiedliche Produkte anbieten können und etwas für die regionale Wertschöpfung tun.
Warum gibt es nicht bereits mehr Agroforstsysteme in Deutschland?
In Brasilien, Peru, Bolivien und anderen südamerikanischen Staaten wird bereits seit Anfang der 2000er-Jahre erfolgreich mit dem Konzept Agroforst gearbeitet. In Deutschland bekommt das Thema erst seit ein paar Jahren mehr Beachtung.
Stattdessen wurde nach der Flurbereinigung und dem Neuordnungsverfahren in den 1950er Jahren auf mechanische und intensivere Landwirtschaft gesetzt. Wertvolle strukturgebende Gehölz- und Baumbereiche wurden nach und nach aus der Landschaft ausgeräumt, um Platz für mehr Ackerfläche zu machen. Das Resultat heute: Weitläufige Monokulturen, die durch jahrzehntelange Maschinen-, Pestizid- und Düngereinsatz auch die angrenzenden anderen Landschaftsbereiche und Ökosysteme mit belasten. In den letzten drei Jahrzehnten ist die Anzahl der Insekten in Deutschland um 75 Prozent geschrumpft.
Mit einer Entwicklung hin zu mehr bäuerlicher, sozial-ökologischer Landwirtschaft tritt auch das eigentlich uralte Konzept Agroforst wieder mit auf den Plan. Denn schon unsere Vorfahren wussten, dass unterschiedliche Ökosysteme und Lebensräume voneinander profitieren können.
Welche Förderung gibt es für das Konzept Agroforst?
Mittlerweile sind Agroforstsysteme im Agrarfördersystem der Bundesrepublik als Teil der beihilfefähigen, landwirtschaftlichen Fläche definiert. Das gilt für Ackerland, Grünland und in Dauerkulturen. Das heißt, Landwirt*innen können unter den richtigen Bedingungen Zuschüsse und Direktzahlungen für Agroforstsysteme bekommen, die sie entweder bereits haben oder neu aufbauen wollen. Sie sind aber als freiwillig definiert.
Petition fordert mehr Bäume an den Äckern
Die BaumLand-Kampagne des Fördervereins bäuerliche Landwirtschaft e.V. (FöbL) geht an dieser Stelle noch weiter. Sie fordert mit einer Petition auf WeAct, der Petitionsplattform von Campact, die Pflanzung und Pflege von 100 Millionen Bäumen und weitere 100.000 Kilometer Hecken, sowie verbindliche Standards, die eine nachhaltige Entwicklung und Pflege von Gehölzen in der Landschaft sicherstellen. Der 3-Punkte-Plan der Kampagne setzt an den bisher spärlichen Fördermaßnahmen an.
Die Petent*innen sagen, dass die Fördermaßnahmen für Agroforstsysteme attraktiver und langfristig finanziert sein müssen, sich an den neuesten fachlichen Standards orientieren und die Nutzung der Feldgehölze ermöglichen sollen. Mehr Infos zum Plan liest Du auf der Seite der Kampagne. Unterstütze auch Du wie bereits über 50.000 weitere Menschen die Petition der BaumLand-Kampagne auf WeAct:
In diesem Video erklärt Campact-Vorstand Christoph Bautz, wie wir mit Hecken, Büschen und Bäumen der Landwirtschaft helfen können.